 Table Ronde
Table Ronde
Eine polyzentrische Wirtschaftsentwicklung der Großregion?
Montag 26.03.12 um 18:30
Im Cercle Cité – AUDITORIUM CITÉ
Langfassung der Transkription (nur auf Französisch): DebatEconomielongfr
Teilnehmer:
- M. Patrick Weiten,
Président du Conseil Général de la Moselle - Mme. Mannes-Kieffer Elisabeth,
Premier conseiller de gouvernement im Luxemburger Wirtschaftsministerium - M. Luc Henzig,
Partner bei PriceWaterhouseCoopers
Moderation :
Carlo de Toffoli & Mike Mathias,
Gréng Stëftung
Nach Auffassung unserer Gäste, befinden die Teilregionen der Großregion sich auf wirtschaftlicher Ebene tendenziell eher in einer Konkurrenzsituation: Beispiele für spontane Zusammenarbeit oder Konzertierung auf institutioneller Ebene werden häufiger, bleiben in ihren Augen aber die Ausnahme. Obwohl die Teilregionen sich ihre Wirtschaftsnischen suchen, ist bisher keine wirkliche Komplementarität entstanden. Daraus ergeben sich mehrere Probleme, welche den sozialen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Dynamik in der Großregion beeinträchtigen: Lohnunterschiede, Diskrepanzen zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt, Mangel an Synergien, usw.
Die Unausgewogenheit ist nicht dermaßen ausgeprägt, dass Luxemburg der einzige Wirtschaftsmotor in der Großregion wäre. Im Gegenteil: Projekte wie die „Megzone von Illange“ in Lothringen illustrieren den Polyzentrismus in der Großregion, der sich nach Ansicht der Gesprächsteilnehmer noch stärker entwickeln sollte. Die Logik hinter einem solchem Argument fasst Luc Henzig aus der Pespektive Luxemburgs zusammen: „Heute muss man die Komplementarität anstreben. Es ist wichtig anzuerkennen, dass die Investitionen unserer Nachbarn auch wichtig für Luxemburg sind. Je reicher unsere Nachbarn, umso besser unsere eigenen Zukunftsaussichten. Wir wissen schließlich nicht, wie die luxemburgische Wirtschaft sich entwickeln wird. Wenn sie abflaut, müssen wir uns auf die Dynamik unserer Nachbarn verlassen können.“ Der Präsident des „Conseil Générale de la Moselle“, Patrick Weiten, argumentiert auf ähnliche Weise und betont: „Die ganze Großregion profitiert von einem Projekt wie der „Megazone“, weil Arbeitsplätze und Logistikinfrastrukturen geschaffen werden.“
Ein sensibles Thema für die Großregion ist die Zukunft ihrer Stahlindustrie. Das Argument der internationalen Wettbewerbsfähigkeit bedroht die Arbeitsplätze in diesem Sektor. Für unsere Gäste ist das Problem jedoch kaum auf Ebene der Großregion zu lösen. Patrick Weiten ist der Meinung, dass „wir hier nur reagieren können und versuchen, Arbeitsplätze zu retten. Man bräuchte aber eine Zusammenarbeit auf europäischer Ebene.“ Weil eine Verständigung über mögliche gesamteuropäische Strategien dort aber nicht stattfinde, seien die einzelnen Regionen zu Alleingängen gezwungen: Patrick Weiten beispielsweise setzt seine Hoffnungen für die lothringische Stahlproduktion in das sogenannte ULCOS-Projekt (Ultra-Low CO2 Steelmaking), dessen Finanzierung aber noch nicht garantiert ist und wiederum von europäischen Geldern abhängt. Elisabeth Mannes-Kieffer bedauert, dass in der EU Umwelt- und Klimaschutzbedenken Priorität haben. Als Ausgleich müsste es ihrer Meinung nach zusätzlich eine „richtige sektorspezifische Industriepolitik geben.“ Und Luc Henzig ergänzt, dass man sich fragen muss, „ob die Nachfrage in Europa hoch genug bleiben wird. Ansonsten ist die einzige Überlebenschance für die europäische Stahlindustrie, dass die Transportkosten enorm steigen und der Import von Stahl sich nicht lohnt.“
Während der Diskussion wurde ein Thema immer wieder angeschnitten: Der Mangel an „Governance“, d.h. einer institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen Teilregionen, besonders im Bereich der Wirtschaftspolitik. Unsere Gäste haben betont, dass wiederholt Versuche von Politikern und Wirtschaftsakteuren unternommen werden, sich über gemeinsame Strategien zu verständigen. Es bleibe aber noch viel zu tun. Luc Henzig formuliert die Situation folgendermaßen: Die Bereitschaft „miteinander zu sprechen“ nehme zu. Patrick Weiten erklärt, dass die Großregion in Frankreich keine anerkannte „Tatsache“ sei: „Obwohl die Regionen viel Autonomie genießen, laufen die bilateralen Beziehungen zu unseren Nachbarn immer noch größtenteils über die Regierung in Paris.“ Trotzdem würden Fortschritte gemacht, beispielsweise sei ein gemeinsames „Elektro-Car-Sharing“-Projekt gemeinsam mit der Luxemburger Regierung auf die Beine gestellt worden, so Weiten: „Und ich bin überzeugt, dass wir uns auch in anderen wichtigen Dossiers einigen können!“
Elisabeth Mannes-Kieffer wendet ein, dass die Zusammenarbeit auf bilateraler und trilateraler Ebene bereits jetzt gut funktioniere: „Man sollte also nicht zu pessimistisch sein. Konkrete Zusammenarbeit findet statt. Beispielsweise wurde kürzlich die Zusammenarbeit innerhalb der ‚Commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise’ institutionalisiert. Hier werden viele gemeinsame Probleme angesprochen, wie die Situation der Grenzgänger, das Gesundheitswesen, ULCOS, Logistik, usw.“ Dann gebe es auch noch das Projekt der „polyzentrischen Metropolregion“. In dessen Rahmen würden in erster Linie Fragen der gemeinsamen Landesplanung behandelt: „Hier ist eine enge Zusammenarbeit geplant. Vielleicht machen wir nur den Fehler, die Öffentlichkeit zu wenig über unsere Aktivitäten zu informieren!“
Eine Veranstaltung der Green European Foundation mit Unterstützung der Gréng Stëftung Lëtzebuerg, gefördert mit Geldern des Europäischen Parlamentes.

 Deutsch
Deutsch  Français
Français 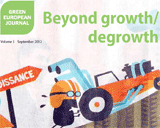 Beyond Old Cleavages
Beyond Old Cleavages Green European Journal
Green European Journal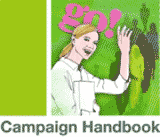 Greens Campaign Handbook
Greens Campaign Handbook